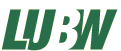Nachhaltigkeit
- Das N!-Büro der LUBW
- Aktuelles und Veranstaltungen
- Nachhaltigkeit als kommunale Aufgabe
- Der Weg zur nachhaltigen Kommune
- Perspektivberatung
- Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Entwicklung Kommunaler Nachhaltigkeitsstrategien
- Umsetzung kommunaler Nachhaltigkeitsprozesse
- Regionale und interkommunale Prozesse
- Nachhaltigkeitswerkstätten
- Nachhaltige öffentliche Beschaffung
- Kommunaler Nachhaltigkeitscheck
- Aktive Kommunen
- Bürgerschaftlicher Klimaschutz
- BNE-Förderungen
Der N!-Check ist gedacht als einfach zu handhabendes Instrument zur Überprüfung, ob ein kommunales Vorhaben mit den Zielsetzungen nachhaltiger Kommunalentwicklung übereinstimmt. Diese Zielsetzungen können – müssen aber nicht – im Rahmen von Gemeindeentwicklungsplänen oder Stadtentwicklungskonzepten verankert sein. Er ist lohnend für alle Vorhaben mit erheblichen und/oder langfristigen Auswirkungen auf die weitere Gemeindeentwicklung. Dazu zählen beispielsweise:
- Städtebauliche Konzepte oder Teilkonzepte in Bereichen wie Energie, Klima, Bildung, Sport und Mobilität sowie einzelne Maßnahmen daraus
- Bauleitplanverfahren (Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss)
- Konkrete Bauvorhaben
Bei der Anwendung für umfassende Konzepte und Programme ist im Unterschied zu konkret abgrenzbaren Maßnahmen und Planungen vorher zu klären, ob das Konzept an sich eingeschätzt werden soll oder die dadurch erhoffte Wirkung.
Der N!-Check ist aber auch sehr wohl für die Nachhaltigkeitseinschätzung kleinerer Vorhaben geeignet, wie zum Beispiel
- Einzelne Beschaffungsmaßnahmen
- Veranstaltungen (Neujahrsempfang, Ausbildungsplatzbörse usw.)
- Einführung und Fortschreibung von Förderprogrammen
Wird der N!-Check verpflichtend als Anlage zu Sitzungsvorlagen eingeführt, so steht ein Positiv-Katalog mit Vorhaben zur Verfügung, für welche ein N!-Check sinnvoll ist.
Der N!-Check sollte erstmals sehr früh in der Projektplanung durchgeführt werden, da die Vorhaben zu diesem Zeitpunkt noch beeinflussbar sind. Es bietet sich an, den N!-Check im Projektverlauf anzupassen bzw. zu wiederholen, insbesondere bei mehrstufigen Planungsphasen, wie es bei Bebauungsplänen der Fall ist.
Sinnvoll ist es, ein Team aus Projektbeteiligten zu bilden, welche die für das Projekt wichtigsten Fachdisziplinen repräsentieren, insbesondere bei komplexeren Vorhaben. Das ermöglicht einen fassettenreichen Blick auf das Vorhaben und fördert das Verständnis für die unterschiedlichen Sichtweisen und mitunter konträren Positionen der Beteiligten. Diesen Vorteil kann man sich auch bei Einbezug externer Akteure zu Nutze machen.
Bei größeren Teams (mehr als 5 Personen) ist eine Aufteilung und zweistufige Bearbeitung zu empfehlen. Nach einer gemeinsamen Einführung in Hintergrund, Stand und Zielsetzung des Projektes, wird zunächst von jedem Kleinteam ein N!-Check erstellt. In einem zweiten Schritt werden die Ergebnisse der einzelnen Teams mit allen Beteiligten zu einem N!-Check zusammengeführt. Dafür werden vorrangig abweichende Einschätzungen ausgetauscht, wenn möglich ein Konsens herbeigeführt oder die verschiedenen Sichtweisen festgehalten.
Einzelbearbeitungen allein durch einen Projektverantwortlichen oder die Umweltbeauftragte haben sich nicht bewährt, weil dabei die ganzheitliche Betrachtung und Diskussion eines Vorhabens nicht möglich ist.
Beim N!-Check werden die unmittelbaren Auswirkungen des betrachteten Vorhabens gegenüber dem bisherigen Zustand betrachtet, also der Zustand z. B. einer Fläche vor und der erwartete Zustand dieser nach Durchführung des Vorhabens. Es ist wichtig, den Betrachtungszeitraum vor Durchführung des N!-Checks mit allen Beteiligten klar festzulegen. Dabei werden die vorhersehbar zu erwartenden Auswirkungen dokumentiert, nicht aber das erhoffte langfristige Potential.
Graue Energie und auswärtig eingesetzte Ressourcen sollten beim N!-Check sehr wohl mit in den Blick genommen werden, aber nur soweit, wie es mit den im Bearbeitungsteam vorliegenden Kenntnissen möglich ist. Eine Beschränkung der Wirkungseinschätzung nur auf das engere Gemeindegebiet wäre dagegen nicht angemessen. Vielmehr sollten in den betreffenden Handlungsfeldern Hinweise auf die Außenwirkungen eines Vorhabens erfolgen.
Für den ersten N!-Check eines Teams sollten mindestens 90 Minuten einschließlich der Projektvorstellung eingeplant werden. Weitere Checks gehen erfahrungsgemäß um einiges schneller, da die Beteiligten die Fragen und Vorgehensweise schon kennen. Im Vergleich zu den langwierigen Bearbeitungszeiten der meisten kommunalen Projekte ist dies gut investierte Zeit, zumal ein Nachhaltigkeitscheck aufgrund seiner fassettenreichen Betrachtungsweise auch ein ganzheitliche Planung und die Akzeptanz der Projekte befördern kann.
Das ist grundsätzlich schon möglich. Dem entgegenwirken soll die Dokumentation der am N!-Check Beteiligten und deren Kurzbegründungen auf dem Formular. Aber selbst, wenn bei bestimmten Handlungsfeldern fragwürdige Einschätzungen gegeben werden, so können diese einfach identifiziert und ggf. korrigiert werden. Dies ist auch der Fall, wenn z. B. Mitglieder des Gemeinderats zu einer anderen Einschätzung kommen als die Verwaltung. Der N!-Check trägt dann dazu bei, dass eine sachliche Diskussion zu den betroffenen Handlungsfeldern geführt werden kann.
Der Befürchtung, dass durch die subjektive Einschätzung z. B. ein geschöntes Bild entstehen könnte, steht die Erfahrung entgegen, dass verschiedene Bearbeitungsteams beim gleichen Vorhaben zwar nicht unbedingt zu identischen, aber sehr ähnlichen Einschätzungen gelangen.
Grundsätzlich ist der für die Entwicklung und Durchführung eines Projektes zuständige Fachbereich auch für die Richtigkeit seiner N!-Checks verantwortlich. Sinnvoll ist, dass die den N!-Check in der Kommune einführende Dienststelle außer Schulungen auch eine Begleitung der Checks anbietet. Unsicherheiten und Verständnislücken lassen sich ausgleichen, wenn die Checks gerade in der Anfangsphase zumindest stichprobenhaft auf Plausibilität überprüft werden. Dies gilt besonders, wenn der N!-Check für einen Positiv-Katalog an Gemeinderatsvorlagen verbindlich eingeführt wird.
Eine quantitative Einschätzung ist bei vielen Handlungsfeldern nicht möglich. Außerdem würde eine Quantifizierung die Bearbeitung des N!-Checks sehr aufwändig und zeitintensiv machen.
Der N!-Check dient der Sensibilisierung für die Belange der Nachhaltigkeit und soll zum lösungsorientierten Denken anregen, um Nachhaltigkeit ins tägliche Handeln zu integrieren. Sein Ziel ist nicht, eine mit messbaren Größen belegte Aussage zu den Nachhaltigkeitswirkungen eines Vorhabens zu machen. Der N!-Check ist kein finales Bewertungsmittel, sondern ein Hilfsmittel für gute Entscheidungen.
Von der quantitative Auswertung des N!-Checks, z. B. mit Aussagen wie „10 hemmende Wirkungen stehen 6 fördernden entgegen“, wird dringend abgeraten. Eine solche Auswertung verleitet dazu, fördernde und hemmende Wirkungen gegenzurechnen bzw. anzunehmen, dass eine fördernde Wirkung eine hemmende Wirkung aufhebt. Das ist aber nicht der Fall!
Gleiches gilt für fördernde und hemmende Wirkungen innerhalb eines Handlungsfeldes, beispielsweise durch Energieeinsparungen im Betrieb eines Neubaus, dem der Energie-einsatz für die Erstellung des Gebäudes gegenübersteht. Auch diese sollen nicht aufgerechnet, sondern durch Kennzeichnung beider Wirkungen transparent gemacht werden.
Damit macht der N!-Check das Spannungsfeld der Auswirkungen sichtbar und zeigt, dass oftmals eine Abwägung zwischen den verschiedenen Bereichen nachhaltiger Entwicklung notwendig ist.
Der N!-Check kann immer nur für ein konkretes Vorhaben gemacht werden. Für alternative Projektvarianten ist jeweils ein gesonderter N!-Check erforderlich. Abweichende Ergebnisse können sehr gut anhand der Kurzfassungen der Checks gegenübergestellt und mit Hilfe der Zusammenfassenden Einschätzung herausgestellt werden.
Handlungsfelder, auf das ein Vorhaben keine Auswirkungen hat, schmälern das Ergebnis des N!-Checks nicht. Eng gefasste Vorhaben wie große Beschaffungsmaßnahmen haben engere Auswirkungen wie die Entwicklung eines großen Baugebietes.
Wichtig ist die Aussage, dass die Einschätzung „Kein Effekt“ zeigt, dass keine hemmenden Auswirkungen zu erwarten sind.
Wichtig ist weiterhin, dass hemmende und fördernde Wirkungen in einem Handlungsfeld nicht „aufgerechnet“ und als „Kein Effekt“ subsummiert werden, sondern beide Wirkungen kenntlich gemacht und kurz erläutert werden.
Es ist davon auszugehen, dass mindestens 50 Kommunen den N!-Check bereits angewendet haben, von der kleinen Gemeinde bis zur Großstadt. Dies ist durch die Zusammenarbeit mit Pilotkommunen, Projekte der HS Kehl und eine Umfrage der LUBW belegt. Seit 2021 werden auf Landesebene Online-Workshops zur Schulung von kommunalen Mitarbeiter:innen angeboten, so dass seit diesem Jahr auch vermehrt N!-Checks in Kommunen durchgeführt werden.
Bisher haben nur wenige Kommunen diesen Schritt gemacht. In einer Umfrage Ende 2021 gaben 12 Kommunen an, dass sie die Einführung des N!-Checks planen.
Um den N!-Check als Regelinstrument nachhaltiger Kommunalentwicklung einzuführen, empfiehlt es sich, dessen Durchführung als freiwillige Selbstverpflichtung zu beschließen. Eine Herangehensweise ist, den N!-Check als Ergänzung von Sitzungsvorlagen für den Gemeinderat einzuführen, indem diese um eine zusätzliche Abfrage ergänzend zu Sachbericht, finanziellen und personellen Auswirkungen erweitert werden, idealerweise auf dem Deckblatt der Vorlage.
Bewährt hat sich, bei der Einführung durch einen Ratsbeschluss zunächst einen Pilotzeitraum festzulegen. An dessen Ende können die Erfahrungen und Herausforderungen zusammengestellt und ggf. Anpassungen vorgenommen werden. Ein weiterer Beschluss verankert das Instrument dann permanent in der Kommune.
Beispiele für Sitzungsvorlagen zur Einführung des N!-Checks sind beim Nachhaltigkeitsbüro erhältlich.
In einer Umfrage Ende 2021 habe den Kommunen folgende Herausforderungen benannt:
- Fehlende personelle Ressourcen bzw. zeitliche Engpässe
- Fehlender politischer Rückhalt
- Fehlende Überzeugung der Verwaltungsspitze
- Anwendung anderer Check-Tools, insbes. eines Klima-Checks
Eine große Zahl kommunaler Entscheidungen sind in ihren Nachhaltigkeitswirkungen nur schwer zu fassen. Dazu zählen zum Beispiel Personalvorlagen aller Art oder Beschlüsse zum Grundstücksverkehr, die zudem der der Diskretion unterliegen und deshalb nicht-öffentlich behandelt werden.
Andere Vorlagen wie Haushaltsplanungen, Jahresabschlüsse oder Wirtschaftspläne von Beteiligungsunternehmen sind so komplex, dass sie sich mit dem einfachen Instrument des N!-Checks nicht fassen lassen.
Die dritte Gruppe von Vorlagen, für die ein N!-Check nicht sinnvoll ist, sind z.B. FNP-Änderungen im Zusammenhang mit B-Plänen und finale Satzungsbeschlüsse über B-Pläne, die besser bis zum Entwurfsbeschluss einem N!-Check unterzogen werden. Auch einfache Sachstandsberichte zur Kenntnisnahme durch den Gemeinderat fallen in diese Gruppe. Beispiele hierfür sind im Positiv-/Negativ-Katalog aufgeführt.
Es gibt erst wenig Erfahrungswerte, wie groß der Anteil der Sitzungsvorlagen ist, für die ein N!-Check sinnvoll ist, wenn das Instrument verpflichtend im Rahmen von Sitzungsvorlagen eingeführt ist.
Nach exemplarischen Auswertungen der Tagesordnungen gemeinderätlicher Gremien anhand des Positiv-/Negativ-Katalogs der Stadt Friedrichshafen müssen zwischen 10 und 40% der Sitzungsvorlagen des Gemeinderates einem N!-Check unterzogen werden. Am geringsten ist der Anteil im Bereich Verwaltung und Finanzen (ca. 10%), am umfangreichsten in Bereich Planen, Bauen und Umwelt (ca. 40%), da hier auch alle Bauvorhaben aus dem Bereich Bildung, Kultur, Soziales und Sport vorberaten werden; dort sind es originär ca. 25%.
Der N!-Check wurde in den Jahren 2017 und 2018 von kommunalen Vertreter:innen gemeinsam mit dem Nachhaltigkeitsbüro der LUBW entwickelt und 2019 und 2020 in rund 30 Pilotkommunen erprobt, u.a. auch in Zusammenarbeit mit der HS Kehl.
Die Erfahrungen der Pilotkommunen, darunter auch Landkreise und eine Verbands-Region, sind im Herbst 2021 über eine Umfrage im Auftrag der LUBW erhoben worden und in die Schärfung der Leitfragen und Anhaltspunkte eingeflossen. Es besteht die Möglichkeit, weiteres Feedback aus anwendenden Kommunen in die Mustervorlage einzuarbeiten.
Die Entwickler:innen des N!-Checks haben sich bei der Zusammenstellung der Handlungsfelder und Leitfragen bewusst an kommunalen Nachhaltigkeitsstrategien orientiert, sodass eine hohe Übereinstimmung zwischen dem N!-Check und den Zielsetzungen nachhaltiger Stadt- und Gemeindeentwicklung besteht. Erste Anpassungen des N!-Checks an kommunale Zielsetzungen haben gezeigt, dass nur der wenige Veränderungen bzw. Ergänzung des ursprünglichen Instruments dafür notwendig sind.
In Anbetracht der gesetzlichen und freiwilligen Verpflichtungen zum Klimaschutz sind Kommunen gefordert, ihre Vorhaben auf die Klima-Auswirkungen zu prüfen. Dabei zum Einsatz kommende Klima-Checks konzentrieren sich auf die Menge und Dauer der CO2-Emissionen, die das Projekt verursacht.
Der N!-Check erlaubt hingegen eine ganzheitliche Betrachtung aller Aspekte nachhaltiger Entwicklung inklusive der Klimawirkungen und zeigt die notwendige Abwägung divergierender Ziele bei einem Projekt auf. Die Nachhaltigkeitsprüfung erlaubt eine ganzheitliche Betrachtung und stellt die positiven Wirkungen eines Projektes heraus, auch wenn Ressourcen-Verbrauch und Energieversorgung – zumindest in einer Übergangsphase – noch mit negativen Auswirkungen verbunden sind.
Es gibt auch die Möglichkeit, dass der N!-Check durch einen speziellen Klima-Check erweitert wird, um die ungefähre Menge und Dauer der projektbedingten Treibhausgas-Emissionen bzw. -Einsparungen in CO2-Äquivalenten einschätzen zu können.