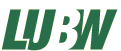null Nördlicher Kammmolch - Triturus cristatus (Laurenti, 1768)



Der Nördliche Kammmolch ist die größte mitteleuropäische Molchart. Entlang des Rückens bildet das Männchen im Frühjahr ein Hochzeitskleid mit einem hohen, deutlich gezackten Rückenkamm aus, dem die Art ihren Namen verdankt und der ihnen ein drachenähnliches Aussehen verleiht. Die Weibchen besitzen keinen Kamm. Von anderen einheimischen Molcharten unterscheidet sich die Art durch die mit schwarzen Flecken durchsetzte intensive Gelbfärbung des Bauches.
Gesamtlänge: 10 bis 15 cm
Gewicht: ca. 10 g
Die Nördlichen Kammmolche können fast alle Typen stehender Gewässer besiedeln, meiden jedoch stark saure sowie Fließgewässer. Ideal sind größere, besonnte, mindestens 70 cm tiefe und fischfreie Gewässer mit reicher Unterwasservegetation, lehmigem Untergrund und nur wenig Faulschlamm am Boden. Oft bewohnt die Art Gewässer in Auwäldern oder in Abbaugebieten wie Kiesgruben und Steinbrüchen. In der Nähe sollten sich geeignete Landlebensräume befinden wie Nasswiesen, lichte Wälder oder Brachen. An Land nutzen Kammmolche Steinhaufen, Mäusebauten, vermodernde Baumstämme sowie Holzstapel als Tagesverstecke.
Nördliche Kammmolche wandern im Frühjahr zur Paarung und Eiablage in die Laichgewässer. Der Paarung geht ein beeindruckendes Balzspiel voran, bei dem das Männchen seine Breitseite präsentiert und entweder eine Art Katzenbuckel oder Handstand macht. Durch peitschenartige Schläge mit dem Schwanz werden dem Weibchen Duftstoffe aus der Kloake zugefächelt. Für die Eiablage biegt das Weibchen mit den Hinterfüßen Wasserpflanzenblätter so um, dass Taschen entstehen. Auf diese Weise sind die darin festgeklebten Eier gut getarnt. Während des Aufenthalts im Gewässer ernähren sich erwachsene Kammmolche von Wasserinsektenlarven, Wasserasseln, Wasserschnecken sowie von Amphibienlarven und -eiern. Auch die Larven leben räuberisch und fressen u.a. Wasserflöhe und Mückenlarven. An Land stehen vor allem Regenwürmer, Schnecken, Insekten und deren Larven auf ihrem Speiseplan.
Gesamtverbreitung:
Das Verbreitungsgebiet des Nördlichen Kammmolchs reicht von Frankreich und England im Westen bis zum Ural und Westsibirien im Osten. Die nördlichsten Vorkommen befinden sich in Südnorwegen und Mittelschweden, die Südgrenze des Areals verläuft durchs mittlere Frankreich, am Nordrand der Alpen und am Südrand des Karpatenbogens entlang bis zur Nordküste des Schwarzen Meeres. Abgesehen von der Nordseeküste und einigen Teilen im Osten und Süden Bayerns besiedelt die Art ganz Deutschland.
Verbreitung in Baden-Württemberg
Der Kammmolch ist in Baden-Württemberg weit, aber nicht gleichmäßig verbreitet. Die Verbreitungsschwerpunkte bilden die nördliche Oberrheinebene, das Bodenseegebiet, das Alpenvorland einschließlich Donautal und die Region am mittleren Neckar. Im Schwarzwald und in der zentralen und westlichen Schwäbischen Alb fehlt er weitgehend.
Bestandsentwicklung in Baden-Württemberg:
Von den 1980er Jahren bis zu den 1990er Jahren erfolgte ein Rückgang der Kammmolch-Nachweise in Baden-Württemberg um ca. 50%. Eine nach Populationsgröße und -vernetzung befriedigende Bestandssituation ist nur noch am nördlichen Oberrhein und im Bereich westlich des Neckars gegeben. In anderen Gebieten sind die Populationen klein, zerstreut und stark isoliert. Der Bestand des Kammmolchs ist in Baden-Württemberg weiterhin rückläufig.
| Rote Liste | Schutzstatus | Verordnungen und Richtlinien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW (2022) | D (2020) | BNatSchG | EG-VO 338/97 Anhang | FFH-Richtlinie Anhang | BArtSchV | ||||
| 3 gefährdet | 3 gefährdet | besonders geschützt | streng geschützt | - | II | IV | - | - | |
Gefährdungsursachen
- Beseitigung von Laichgewässern (Verfüllung, Trockenlegung)
- Veränderung der Uferstruktur (z.B. Beseitigung der Flachwasserzonen), zunehmende Beschattung
- Entfernen der Unterwasservegetation
- Fischbesatz in Laichgewässern
- Überhöhte Stickstoffeinträge und Gefährdung durch Biozide
- zunehmende Isolierung der Populationen
Schutzmaßnahmen
- Erhaltung bzw. Neuanlage von Aufenthalts- und Laichgewässern einschließlich der Landlebensräume und der Wanderkorridore zwischen den jeweiligen Teillebensräumen
- Offenhaltung der Laichgewässer (Beschattung verhindern)
- Verhinderung des Eintrags von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln in die Laichgewässer durch Einrichtung von Pufferzonen in Form von Grünland und Gebüsch
- Verhinderung von Fischbesatz in Kleingewässern
Schutzprojekte
- Umsetzung der FFH-Richtlinie
- Art des Zielartenkonzepts Baden-Württemberg
Die FFH-Richtlinie ist eine Naturschutz-Richtlinie der EU, deren Namen sich von Fauna (= Tiere), Flora (= Pflanzen) und Habitat (= Lebensraum) ableitet. Wesentliches Ziel dieser Richtlinie ist die Erhaltung der Biologischen Vielfalt durch den Aufbau eines Schutzgebietssystems. Neben der Ausweisung von Schutzgebieten (FFH-Gebieten) für Arten des Anhangs II wird der Erhaltungszustand dieser und der Arten des Anhangs IV und V überwacht.
FFH-Gebiete
Eine Karte der FFH-Gebiete mit Vorkommen des Kammmolchs und weitere Informationen zu den Gebieten erhalten Sie im
Daten- und Kartendienst der LUBW.
Erhaltungszustand in Baden-Württemberg
| Verbreitungsgebiet | Population | Habitat | Zukunftsaussichten | |
|---|---|---|---|---|
| Einzelbewertung | günstig | ungünstig-unzureichend | ungünstig-unzureichend | ungünstig-unzureichend |
| Gesamtbewertung | ungünstig-unzureichend | |||
2024
Erhaltungszustand der FFH-Arten in Baden-Württemberg (pdf; 0,6 MB)