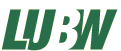Die Umweltindikatoren können zurzeit nicht aktualisiert werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Nachhaltig handeln in Baden-Württemberg heißt
… die Lebensgrundlagen und die vielfältige Natur sowie die einzigartigen Kulturlandschaften des Landes zu schützen und zu erhalten sowie Belastungen für Mensch, Natur und Umwelt auch über das Land hinaus möglichst gering zu halten.
Artenvielfalt und Landschaftsqualität
Durchgängigkeit der Fließgewässer für Lachse
Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert
Waldzustand |  |
Rund 38 Prozent der Landesfläche Baden-Württembergs sind von Wald bedeckt. Wälder sind ein wichtiger Rohstofflieferant, sie haben eine große Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz und sind ein Ort der Erholung und Freizeitgestaltung. Darüber hinaus sind Wälder unverzichtbar für den Boden-, Wasser- und Klimaschutz.
Zunächst durch Luftschadstoffe, wird der Wald seit Anfang der 2000er Jahre immer mehr durch die Auswirkungen des Klimawandels belastet. Steigende Temperaturen und häufiger auftretende Dürreperioden belasten die Wälder und machen sie anfällig für Krankheiten und Schädlingsbefall.
Die Erfassung der Waldschäden basiert auf einer Beurteilung der Baumkronen. Die Bewertung des Waldzustandes erfolgt in fünf Kombinationsschadstufen (0 = ungeschädigt bis 4 = abgestorben). Dargestellt wird der Anteil deutlich geschädigter Bäume der Stufen 2 bis 4 (mittelstark geschädigt bis abgestorben) in Prozent. Als deutlich geschädigt gelten Bäume, die einen Nadel- beziehungsweise Blattverlust oder einen Anteil der Vergilbung von mehr 25 Prozent aufweisen
Die Waldwirtschaft verfolgt das Ziel, naturnahe, möglichst stabile, arten- und strukturreiche Mischwälder zu fördern. Derartige Wälder lassen ein hohes Maß an Widerstandskraft, Regenerationsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit gegenüber Umweltveränderungen erwarten.
40 Prozent der Bäume in den Wäldern Baden-Württembergs sind deutlich geschädigt. Das sind fast doppelt so viele wie noch Anfang der 1990er Jahre und trotz einer leichten Erholung in den vergangenen zwei Jahren zeigt der 10-Jahres-Trend noch immer nach oben.
Jüngere Bäume mit einem Alter von weniger als 60 Jahren weisen deutlich geringere Nadel- und Blattverluste auf als ältere Bäume. Zudem ist der mittlere Nadel- und Blattverlust der jüngeren Bäume seit dem Jahr 1990 nur geringfügig angestiegen. Dies lässt auf eine klimaanpassungsfähigere nächste Waldgeneration hoffen.
Die im Herbst 2024 veröffentlichten Ergebnisse der Bundeswaldinventur 2022 zeigen durchaus positive Entwicklungen: auf 88 Prozent der Fläche wachsen Mischwälder, der Anteil an klimaanpassungsfähigen Bäumen hat zugenommen und der Laubbaumanteil in der Verjüngung liegt bei mehr als 70 Prozent.
Artenvielfalt und Landschaftsqualität | Bewertung für Teilindikator Feldvogelarten |
|
Die Bestandsentwicklungen ausgewählter Vogelarten stehen stellvertretend für den Zustand der Artenvielfalt in unterschiedlichen Landschaftstypen und spiegeln mittelbar die Nachhaltigkeit der Landnutzung wider. In Baden-Württemberg sind die Landschaftstypen Agrarland, Wald und Siedlung sowie Binnengewässer relevant.
Der Indikator Artenvielfalt und Landschaftsqualität bezieht sich auf den Zustand der Normallandschaft. Diese ist die genutzte und nicht besonders geschützte Landschaft, die über 90 Prozent der Fläche Deutschlands ausmacht. Dargestellt wird die quantitative Bestandsentwicklung repräsentativer Vogelarten. Die Daten werden aus dem seit 1992 laufenden „Monitoring häufiger Brutvögel“ (MhB) ermittelt. Ausgewählte Brutvögel stehen stellvertretend für den Zustand der Artenvielfalt in unterschiedlichen Landschaftstypen und spiegeln mittelbar die Nachhaltigkeit der Landnutzung wider. Der Landesindikator Baden-Württemberg besteht aus den vier Teilindikatoren Agrarland, Wälder, Siedlungen und Binnengewässer. Feldlerche, Feldsperling und Goldammer sind potenzielle Indikatorarten des Teilindikators Agrarland Baden-Württemberg. Der jeweilige Bestandsindex wird hier exemplarisch dargestellt.
Der Rückgang der Biodiversität in den Agrarökosystemen des Landes soll gestoppt und für die typischen Arten der Agrarlandschaft soll ein Aufwärtstrend erreicht werden. Ein Zielwert ist für Baden-Württemberg nicht definiert.
Bei allen drei dargestellten Feldvogelarten ist ein abnehmender Trend zu beobachten, beim Feldsperling sogar stark abnehmend. Dies zeigt, dass die Habitatbedingungen für Feldvogelarten weiterhin große Defizite aufzeigen, so dass eine Trendumkehr bisher noch nicht herbeigeführt werden konnte. Aus diesen Gründen wird zurzeit für Baden-Württemberg eine landesweite Konzeption zum Schutz von Feldvogelarten erarbeitet, welche möglichst rasch in die Umsetzung gebracht werden soll.
Stickstoff ist ein wichtiger Nährstoff für das Pflanzenwachstum. In der Landwirtschaft wird Stickstoff deshalb in organischen und chemischen Düngern auf die bewirtschafteten Flächen ausgebracht und kann so als Nitrat ins Grundwasser gelangen. Ein zu hoher Eintrag von Nitrat über das Grundwasser in Bäche und Flüsse kann zu einem Überangebot an Nährstoffen und dadurch zu einer Veränderung der Lebensraumfunktionen dieser Gewässer führen, die oft durch übermäßiges Wachstum von Algen gekennzeichnet ist.
Betrachtet wird der Anteil der Messstellen mit einem Nitratgehalt über 50 Milligramm pro Liter (mg/l) sowie der Anteil der Messstellen mit einem Nitratgehalt über 25 mg/l. Herangezogen werden 120 seit 1994 durchgehend beprobte Messstellen in ganz Baden-Württemberg (EUA-Messnetz).
Das Ziel in Baden-Württemberg ist die Erhaltung eines guten Zustands des Grundwassers gemäß Wasserrahmenrichtlinie bzw. der Grundwasserverordnung. Dazu darf die Nitratkonzentration 50 mg/l nicht überschreiten.
Im Jahr 2022 wurde an 6,7 Prozent der betrachteten 119 Messstellen eine Überschreitung des Schwellenwerts von 50 Milligramm pro Liter festgestellt. Langfristig zeigt die Nitratbelastung des Grundwassers einen rückläufigen Trend, welcher seit einigen Jahren jedoch stagniert. Nitrat stellt weiterhin die Hauptbelastung des Grundwassers dar.
Weitere Informationen finden Sie auf den Themenseiten Grundwasser unter LUBW.Baden-Württemberg > Themen > Wasser sowie unter Länderinitiative Kernindikatoren LIKI.
Die biologische Durchgängigkeit in Fließgewässern hat eine herausragende Bedeutung für die Erhaltung und Wiederherstellung von natürlichen Verhältnissen mit artenreichen und gewässertypischen Lebensgemeinschaften, insbesondere für die heimische Fischfauna.
Für den Indikator ökologische Durchgängigkeit in Fließgewässern werden die Lachsprogrammgewässer in Baden-Württemberg betrachtet. Die für die Aufwärtswanderung des Lachses durchgängigen Querbauwerke im Rheineinzugsgebiet werden ins Verhältnis zur Gesamtzahl der vorhandenen Querbauwerke mit einer Absturzhöhe von mindestens 1 Meter gesetzt. Die in Bezug auf den Fischaufstieg durchgängigen Querbauwerksstandorte sind mit Wanderhilfen wie Fischtreppen ausgestattet. Angaben in Prozent.
Um alle Laichhabitate und Jungfischlebensräume zu erschließen, ist die weitere Herstellung der aufwärtsgerichteten Durchgängigkeit bis zum Zielwert 100 Prozent erforderlich.
Um die biologische Vielfalt nachhaltig zu sichern, sind ausreichend große Flächen erforderlich, auf denen sich die Natur ohne belastende Eingriffe des Menschen entfalten kann.
Dargestellt ist der Anteil der bundeseinheitlich nach Naturschutzrecht streng geschützten Gebiete (Naturschutzgebiete, Kern- und Pflegezonen der Nationalparke und des Biosphärenreservates) an der Landesfläche in Prozent.
Der Anteil der Naturschutzflächen an der Landesfläche liegt aktuell bei 2,8 Prozent. Die Ausweisung des Nationalparks Schwarzwald im Jahr 2014 hatte zur letzten deutlichen Ausweitung der Naturschutzflächen in Baden-Württemberg geführt.
Weitere Informationen finden Sie im Schutzgebietsverzeichnis für Baden-Württemberg unter LUBW.Baden-Württemberg > Themen > Natur und Landschaft > Flächenschutz > Schutzgebietsverzeichnis
In der Agrarlandlandschaft sind naturnahe Landschaftselemente sowie extensiv genutzte Flächen von großer Bedeutung für den Schutz der biologischen Vielfalt. Durch die systematische Erfassung von Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert (High Nature Value Farmland-Flächen, HNV Farmland-Flächen) können Auswirkungen unter anderem der Agrarpolitik in Hinblick auf die Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft aufgezeigt werden.
Anteil der Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert an der gesamten Landwirtschaftsfläche in Prozent. Es wird unterschieden zwischen Flächen mit äußerst hohem (Stufe I), sehr hohem (Stufe II) und mäßig hohem Naturwert (Stufe III).
Baden-Württemberg will die Landwirtschaft stärker im Sinne der Nachhaltigkeit sowie der Erhaltung der Biodiversität entwickeln. Ein Zielwert ist für Baden-Württemberg nicht definiert.
Im Jahr 2023 lag der Anteil von Landwirtschaftsflächen mit einem hohen Naturwert in Baden-Württemberg bei 19,3 Prozent der gesamten Agrarlandschaftsfläche. Nach der ersten Erhebung im Jahr 2009 war zunächst ein Rückgang der HNV-Farmland-Flächen zu beobachten. Mitte der 2010er-Jahre wurde diese Entwicklung gestoppt und seither zeigt sich ein steigender Trend, der sich vor allem auf eine Zunahme der Flächen mit sehr hohem und äußerst hohem Naturwert stützt.
Weitere Informationen finden Sie unter LUBW.Baden-Wuerttemberg.de > Themen > Natur und Landschaft > Flächenschutz > HNV farmland-Indikator sowie unter Länderinitiative Kernindikatoren LIKI.
In Baden-Württemberg wurde im Untersuchungszeitraum 2015 bis 2017 bei knapp 53 Prozent der Messstellen an Fließgewässern nur ein mäßiger, unbefriedigender oder schlechter ökologischer Zustand festgestellt. Hauptursache für die unzureichenden Qualitätsklassen sind unter anderem zu hohe Belastungen durch ortho-Phosphat, das im Gewässer als Nährstoff wirkt und zu übermäßigem Algenwachstum führt. Phosphat wird überwiegend aus kommunalen Kläranlagen sowie diffus von landwirtschaftlich genutzten Flächen eingetragen. Zwar ist der Einsatz von Phosphaten in Haushaltswaschmitteln heute stark eingeschränkt, u.a. in Maschinengeschirrspülmitteln werden Phosphate aber weiterhin verwendet.
Dargestellt wird die über kommunale Kläranlagen in Gewässer eingeleitete Jahresfracht an Gesamtphosphor in Tonnen pro Jahr. Der Summenparameter Gesamtphosphor (Pges) umfasst im Abwasser alle organischen Phosphorverbindungen und die anorganischen Phosphorverbindungen ortho-Phosphat-Phosphor und Polyphosphat.
Seit 2015 werden im Rahmen des „Handlungskonzeptes Abwasser“ mittels Überwachungs- und Modellierungskonzepten diejenigen Wasserkörper in Baden-Württemberg identifiziert, in denen Nährstoffdefizite zu einem maßgeblichen Anteil auf Einträge aus Kläranlagen zurückzuführen sind, um dort gezielt Maßnahmen zur Optimierung der Phosphorelimination zu fördern.
Seit 2010 konnten die Jahresfrachten an Gesamtphosphor mehr als halbiert werden. In den Jahren 2010 bis 2015 wurden besonders in dem insgesamt als defizitär betrachteten Neckargebiet Maßnahmen zur Reduktion der Phosphatfrachten durchgeführt, was zu einem deutlichen Rückgang der Frachten geführt hat.
Trotz Lieferengpässen bei den zur Elimination von Phosphor benötigten Fällungsmitteln aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine blieb die Phosphoreinleitung aus Kläranlagen im Jahr 2022 auf dem vergleichsweise niedrigen Niveau des Vorjahres.
Phosphorverbindungen sind wertvolle Grundstoffe für die Düngemittelherstellung und die chemische Industrie. Ab 2029 sind grundsätzlich alle Betreiber von kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen unabhängig von der jeweiligen Ausbaugröße zu einer Phosphorrückgewinnung aus dem Klärschlamm verpflichtet.
Weitere Informationen finden Sie unter: LUBW 2021 – Wirkung und Kosten von ausgewählten Maßnahmen zur Reduzierung von Phosphoreinträgen aus Kläranlagen