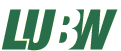Relevante Luftschadstoffe
Als Luftverunreinigungen werden gemäß dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) alle Veränderungen der natürlichen Zusammensetzung der Luft bezeichnet, insbesondere durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe und Geruchsstoffe. Laut der 39. BImSchV ist ein Schadstoff "jeder in der Luft vorhandene Stoff, der schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die Umwelt insgesamt haben kann". Im Rahmen des Umweltschutzes zählen zu den relevanten Luftschadstoffen die Stoffe, für die aufgrund gesetzlicher Vorgaben eine Messverpflichtung besteht und für die es Beurteilungswerte gibt.
An den Messstationen des Landes Baden-Württemberg werden je nach Lage und lokaler Immissionssituation unterschiedliche Luftschadstoffe gemessen, zu denen hier kurz einige Informationen gegeben sind. Weiterführende Informationen zu den Luftschadstoffen finden Sie im Internetangebot des Umweltbundesamtes.
Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2) werden unter der Bezeichnung Stickstoffoxide (NOx) zusammengefasst.
Quellen
Stickstoffoxide entstehen bei allen Verbrennungsprozessen unter hohen Temperaturen. Bedeutende Emissionsquellen sind der Kraftfahrzeugverkehr und die Verbrennung fossiler Brennstoffe. Zu den natürlichen Quellen zählen Blitze in Gewitterwolken. In der Atmosphäre wird das überwiegend freigesetzte Stickstoffmonoxid vergleichsweise schnell in Stickstoffdioxid umgewandelt. Die Umwandlungszeit ist von der Tages- und Jahreszeit sowie von der Ozonkonzentration abhängig. Tagsüber und im Sommer erfolgt die Umwandlung rasch, nachts und im Winter wesentlich langsamer.
Wirkungen auf Mensch und Umwelt
Stickstoffoxide wirken reizend auf die Schleimhäute sowie die Atemwege des Menschen und können Pflanzen schädigen. Auch eine Zunahme von Herz-Kreislauferkrankungen kann beobachtet werden.
Stickstoffdioxid ist zusammen mit den flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) eine der Vorläufersubstanzen für die Bildung von bodennahem Ozon.
Stickstoffoxide tragen durch die langfristige Umwandlung in Nitrat und nachfolgender Deposition zur Überdüngung der Böden in empfindlichen Ökosystemen und Gewässern bei. Über die Umwandlung zu Salpetersäure leisten sie einen Beitrag zur Versauerung.
Beurteilungswerte
Siehe hier.
Partikel (Particulate Matter, PM) sind luftgetragene feste oder flüssige Teilchen, die nicht unmittelbar zu Boden sinken, sondern eine gewisse Zeit (in der Größenordnung mehrerer Tage) in der Atmosphäre verweilen und über große Distanzen transportiert werden können.
Die Größe der Partikel und ihre Zusammensetzung bestimmen neben den chemischen und physikalischen Eigenschaften auch ihre Wirkung auf Mensch und Umwelt. Es werden vier Fraktionen hinsichtlich des Durchmessers der Staubpartikel unterschieden, wobei die gröberen Fraktionen immer auch die kleineren Partikel beinhalten.
Die Partikel der Fraktionen kleiner als 10 µm werden auch als Feinstaub bezeichnet.
| Staubfraktion | Partikelgröße | ||
| Grobstaub | > 10 µm | ||
| Feinstaub | Partikel PM10 | inhalierbar | ≤ 10 µm |
| Partikel PM2,5 | lungengängig | ≤ 2,5 µm | |
| Partikel PM0,1 | blutgängig | ≤ 0,1 µm | |
Quellen
Es werden primäre und sekundäre Partikel unterschieden.
Primäre Partikel werden direkt in die Umwelt emittiert und können natürlichen Ursprungs sein (z. B. als Folge von Bodenerosion) oder durch menschliches Handeln freigesetzt werden (beispielsweise durch Verkehr und Feuerungsanlagen).
Sekundäre Partikel entstehen erst in der Atmosphäre durch eine chemische Reaktion aus gasförmigen Vorläufersubstanzen wie Schwefeldioxid, Stickstoffoxiden oder Ammoniak.
Wirkungen auf Mensch und Umwelt
Vor allem die Partikel der Fraktionen PM0,1 und PM2,5 sind für Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit bedeutsam. Aufgrund ihrer guten Lungengängigkeit können sie weit in den Organismus vordringen und Beschwerden des Atemtraktes und des Herz-Kreislaufsystems verursachen.
Beurteilungswerte
Siehe hier.
Ozon (O3) ist ein chemisch sehr reaktives Gas. In der Stratosphäre oberhalb von etwa 20 km schützt es als natürliche Ozonschicht vor der schädlichen Ultraviolettstrahlung der Sonne. Ozon kommt natürlicherweise auch in den bodennahen Luftschichten vor. Die natürliche Hintergrundkonzentration beträgt hier im Mittel etwa 50 µg/m³.
Quellen
Bodennahes Ozon stammt zu einem geringeren Teil aus dem vertikalen Transport von Ozon aus der Stratosphäre bzw. Ozonschicht. Hauptsächlich wird es aber bei intensiver Sonneneinstrahlung durch photochemische Reaktionen der Vorläufersubstanzen, insbesondere Stickstoffdioxid und flüchtige organische Verbindungen (VOC), gebildet. Ozon wird somit nicht direkt aus Quellen emittiert, sondern bildet sich erst in der Atmosphäre.
Wirkungen auf Mensch und Umwelt
Ozon wirkt in erhöhten Konzentrationen als Reizgas auf die Atemwege und kann nach tiefer Inhalation (z. B. bei sportlicher Betätigung) die Entstehung entzündlicher Prozesse im Lungengewebe fördern. Die Empfindlichkeit gegenüber Ozon ist dabei sehr individuell ausgeprägt.
Zudem können erhöhte Ozonkonzentrationen in Bodennähe das Pflanzenwachstum beeinträchtigen.
Beurteilungswerte
Siehe hier.
Schwefeldioxid (SO2) ist ein farbloses, stechend riechendes und wasserlösliches Gas.
Quellen
Schwefeldioxid entsteht bei der Verbrennung fossiler schwefelhaltiger Brennstoffe, insbesondere von Kohle und Heizöl.
Wirkungen auf Mensch und Umwelt
Schwefeldioxid reizt die Schleimhäute und die Atemwege. Die Kombination von Schwefeldioxid und Stäuben verstärkt die negative Wirkung auf die Gesundheit erheblich.
Des Weiteren schädigt Schwefeldioxid die Pflanzen; insbesondere Nadelhölzer, Moose und Flechten reagieren empfindlich auf erhöhte Schwefeldioxidkonzentrationen in der Luft.
Der Abbau von Schwefeldioxid in der Atmosphäre erfolgt durch Oxidation zu Sulfat und Schwefelsäure, die als Niederschlag ausgetragen wird. Schwefeldioxid trägt damit zur Versauerung von Böden und Gewässern sowie zu säurebedingten Korrosions- und Verwitterungsschäden an Metallen und Gestein (z. B. an Gebäuden) bei.
Beurteilungswerte
Siehe hier.
Kohlenmonoxid (CO) ist ein geruchloses, brennbares und wasserlösliches Gas.
Quellen
Kohlenmonoxid entsteht bei der unvollständigen Verbrennung kohlenstoffhaltiger Brennstoffe wie Benzin, Öl, Holz und Kohle. Einer der Hauptemittenten ist der Verkehr.
Wirkungen auf Mensch und Umwelt
Kohlenmonoxid wirkt in höheren Konzentrationen giftig, indem es den Sauerstofftransport im Blut blockiert. Vergiftungen sind um so eher möglich, je höher die Konzentration ist und je länger die Einwirkung dauert. Akute Vergiftungserscheinungen treten vor allem in geschlossenen Räumen mit laufenden Verbrennungsmotoren (z. B. Garagen) auf.
In der Außenluft lassen sich üblicherweise nur relativ geringe Konzentrationen nachweisen, welche sich jedoch bei längerer Exposition ebenfalls belastend auf den Menschen, insbesondere empfindliche Bevölkerungsgruppen wie ältere Menschen, Schwangere, Kinder oder Menschen mit Vorerkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, auswirken können.
Beurteilungswerte
Siehe hier.
Benzol (C6,H6) ist der einfachste aromatische Kohlenwasserstoff. Die Flüssigkeit hat einen charakteristischen Geruch und tritt leicht in die Gasphase über.
Quellen
Die Hauptemissionsquellen von Benzol sind die Verbrennung von Benzin in Kraftfahrzeugen, Verdunstungsverluste beim Betanken und bei Heiß-/Warmabstellvorgängen aus den Motoren sowie Freisetzungen bei der industriellen Produktion. Eine weitere Quelle sind Holzfeuerungsanlagen.
Wirkungen auf Mensch und Umwelt
Die Aufnahme von Benzol in den menschlichen Körper erfolgt über die Atemwege.
Benzol ist toxisch, jedoch spielen toxische Effekte in den in der Außenluft auftretenden Konzentrationsbereichen nur eine untergeordnete Rolle. Relevant ist die kanzerogene und erbgutschädigende Wirkung von Benzol bei längerer Exposition.
Beurteilungswerte
Siehe hier.
Ammoniak (NH3) ist ein wasserlösliches, stechend riechendes Gas.
Quellen
In der Natur entsteht Ammoniak bei der mikrobiellen Zersetzung stickstoffhaltiger organischer Materie (z. B. abgestorbene Pflanzenreste, tierische Exkremente), bei der sogenannten Huminifizierung.
Anthropogene Ammoniakemissionen stammen überwiegend aus der Landwirtschaft; mit rund 90 Prozent aus der Intensivtierhaltung (insbesondere Rinderhaltung). Von Bedeutung sind hier vor allem die Emissionen von Tierställen sowie die Lagerung und Ausbringung von Gülle und Festmist.
Eine weitere, nicht landwirtschaftliche Quelle ist der Verkehr. Durch den Einbau des Dreiwege-Katalysators bei benzinbetriebenen Kraftfahrzeugen hat im Bereich des Verkehrs die Ammoniakemission an Bedeutung zugenommen.
Wirkungen auf Mensch und Umwelt
Ammoniak wirkt reizend auf Augen, Schleimhäute und den Atemtrakt.
Aufgrund der schnellen Umsetzung in der Atmosphäre, lagert sich das freigesetzte Ammoniak daher überwiegend in unmittelbarer Emittentennähe als trockene Deposition ab. Als einzige basische Komponente reagiert der Hauptteil des Ammoniaks mit den in der Atmosphäre vorhandenen Säuren wie Schwefel- oder Salpetersäure. Dabei wird Ammoniak zu Ammonium (NH4+) bzw. seinen Salzen Ammoniumsulfat ((NH4)2SO4) und Ammoniumnitrat (NH4NO3) umgewandelt, die über weite Strecken in emittentenferne Regionen transportiert werden können. Dort können sie als nasse Deposition über die Niederschläge ausgewaschen werden und in den Boden gelangen. Diese sekundär gebildeten Partikel tragen somit zur Feinstaubbelastung und durch ihre versauernde und eutrophierende Wirkung auch zur Gefährdung empfindlicher Ökosysteme bei.
Beurteilungswerte
Der Schutz empfindlicher Pflanzen und Ökosysteme bei Einwirkung von Ammoniak ist nach Nr. 4.8. der TA Luft 2021 zu gewährleisten. Dabei wird nach Anhang 1 der TA Luft (2021) davon ausgegangen, dass keine erheblichen Nachteile für die empfindlichen Ökosysteme bestehen, wenn innerhalb eines ermittelten Mindestabstands um die Emissionsquelle die Ammoniakkonzentration von 2 µg/m³ nicht überschritten wird.
Die UNECE (2010) empfiehlt zum Schutz der naturnahen Vegetation eine maximale Ammoniakkonzentration (Critical Level) für niedere Pflanzen wie Flechten und Moose in Höhe von 1 µg/m³ und für höherer Pflanzen von 2- 4 µg/m³.
Insgesamt werden die Höchstmengen an Ammoniakemissionen durch die 39. BImSchV vom 2. August 2010 festgeschrieben. Damit hat sich Deutschland verpflichtet, seine Ammoniakemissionen auf 550 Kilotonnen pro Jahr zu reduzieren. Dieses Ziel kann nur durch verstärkte Minderungsmaßnahmen bei der Ammoniakemission im Bereich der Intensivtierhaltung erreicht werden.
Zu den relevanten Inhaltsstoffen, die in der Staubfraktion Partikel PM10 ermittelt und beurteilt werden, zählen u. a.:
- Arsen (As), Blei (Pb), Kadmium (Cd) und Nickel (Ni), welche unter dem Begriff „Schwermetalle" zusammengefasst werden.
- Benzo[a]pyren (C20H12, BaP), das zur aus mehreren Hundert Einzelverbindungen bestehenden Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) gehört; im Allgemeinen wird es als Leitsubstanz für die Gruppe der PAK herangezogen. Benzo[a]pyren ist nur gering flüchtig und liegt in der Atmosphäre partikelgebunden vor.
- Ruß, das heißt Partikel, die bei der unvollständigen Verbrennung kohlenstoffhaltiger Brennstoffe (wie Öl, Kohle, Holz) entstehen. Rußpartikel bestehen aus Kohlenstoff und weisen eine Größe von ca. 0,01 bis 1 µm auf.
Quellen
Die Hauptquellen atmosphärischer Emissionen von Arsen, Kadmium und Nickel sind die Verbrennung von Öl und Kohle in Feuerungsanlagen.
Blei wurde bis zum Verbot bleihaltiger Zusätze in Kraftstoffen hauptsächlich durch den Verkehr freigesetzt.
Freisetzungen von Benzo[a]pyren in die Luft werden nicht nur durch den Verkehr verursacht, sondern überwiegend durch Verbrennungsprozesse in Feuerungsanlagen, so dass hohe Benzo[a]pyrenkonzentrationen vor allem im Umfeld von Holz- und Kohlefeuerungen auftreten. PAK reichern sich in der Umwelt an und werden kaum abgebaut. Sie lassen sich ubiquitär nachweisen.
Ruß entsteht bei der unvollständigen Verbrennung bzw. der thermischen Spaltung von dampfförmigen kohlenstoffhaltigen Substanzen. Wichtige Quellen sind Fahrzeuge und Maschinen ohne Partikelfilter, Holzfeuerungen und offene Feuer mit Wald-, Feld- und Gartenabfällen.
Wirkungen auf Mensch und Umwelt
Während reines elementares Arsen nicht giftig ist, weisen die dreiwertigen, löslichen Arsenverbindungen ein hohes akut toxisches Potenzial auf.
Bei den anderen Schwermetallen haben weniger akut toxische Effekte Bedeutung für gesundheitliche Beeinträchtigungen als vielmehr die Akkumulation im Körper aufgrund langjähriger Exposition und inhalativer oder oraler Aufnahme.
Blei kann u. a. zu ierdenfunktionsstörungen, zu Schäden des blutbildenden Systems und der Muskulatur sowie des Nervensystems führen. Zudem kann es fruchtschädigend wirken und die Zeugungsfähigkeit beeinträchtigen.
Kadmium kann u.a. den Eiweiß- und Kohlenhydrastoffwechsel stören sowie Knochenschäden und Erkrankungen des Immun- und Nervensystems verursachen. Bestimmte Kadmiumverbindungen sind kanzerogen und erbgutschädigend.
Nickel ist ein häufiger Auslöser für Kontaktallergien und kann u. a. die Lunge und das Immunsystem schädigen. Es wirkt außerdem fruchtschädigend. Nickelstäube stehen ferner im Verdacht, kanzerogen zu sein.
Die PAK einschließlich Benzo[a]pyren sind toxisch, einige PAK sind kanzerogen und stehen im Verdacht, frucht- und erbgutschädigend zu sein.
Ruß gilt als kanzerogen. Dabei beruht die schädigende Wirkung des Rußes auch auf anhaftenden Substanzen, wie z. B. krebserregende PAK, welche ebenfalls bei Verbrennungsprozessen entstehen und zusammen mit dem Ruß in den Körper gelangen können.
Beurteilungswerte
Siehe hier.
Für Ruß besteht derzeit kein rechtlich verbindlicher Ziel- oder Grenzwert. Die 23. BImSchV (aufgehoben im Juli 2004) enthielt einen Maßnahmenwert von 8 µg/m³ für das Jahresmittel.
Über den interaktiven Dienst UDO (Umwelt-Daten und -Karten Online) der LUBW können einzelne Daten bis hin zu mehrjährigen Zeitreihen der relevanten Luftschadstoffe abgerufen werden. Die gemäß der 39. BImSchV wichtigsten Kenngrößen der relevanten Luftschadstoffe werden als jahresscharfe Auswertungen unter Daten und Auswertungen bereitgestellt.