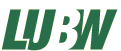null Blauschillernder Feuerfalter - Lycaena helle Denis & Schiffermüller, 1775



Der Blauschillernde Feuerfalter gehört zu den Bläulingen. Der namengebende blauviolette Schillereffekt umfasst beim Männchen bis auf die Randbereiche die gesamte Flügeloberseite, während sich dieser beim Weibchen nur auf Teile des Flügels beschränkt. Die Oberseite der Vorderflügel beider Geschlechter weist auf orangefarbenem Grund bogenförmige, dunkle Punktreihen auf, die Hinterflügel sind braun mit einer orangefarbenen Endbinde.
Flügelspannweite: 25 mm
Entwicklungsdauer: 1 Jahr
Flugzeit: Ende Mai bis Ende Juni
Der Blauschillernde Feuerfalter besiedelt in Baden-Württemberg nasse Niedermoor- und Zwischenmoorkomplexe und extensiv genutzte Feuchtwiesen(-brachen). Geeignete Flächen sind - u.a. als Ergebnis unregelmäßiger oder fehlender Bewirtschaftung - durchsetzt mit Faulbaum- und Weidengebüschen. Sowohl die Raupen als auch die Falter benötigen windgeschützte und besonnte Bestände des Wiesen-Knöterichs (Polygonum bistorta), der Futterpflanze. Auf regelmäßig gemähten oder beweideten Flächen, selbst mit hohen Wiesen-Knöterich-Beständen, kann sich der Blauschillernde Feuerfalter nicht halten.
Die Weibchen des Blauschillernden Feuerfalters legen ihre Eier einzeln auf Blätter des Wiesen-Knöterichs. Die Raupen schlüpfen bald danach, fressen und wachsen, bis sie sich im August auf der Blattunterseite verpuppen. Später im Herbst fallen die Puppen herunter und überwintern in der Bodenstreu. Ab Ende Mai des nächsten Jahres erscheinen die Falter.
Gesamtverbreitung
Verbreitung in Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg gibt es nur eine bekannte Population in der Riedbaar bei Donaueschingen.
Bestandsentwicklung in Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg ist nur eine Population bekannt, weitere alte Fundmeldungen sind fragwürdig. Nach langjähriger Stabilität sind aktuell,trotz Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des Artenschutzprogramms, Habitatveränderungen erkennbar, die zu einem Lebensraum- und Populationsverlust führen. Das insgesamt kleinflächige und isolierte Habitat ist hohen Randeffekten ausgesetzt. Nährstoffeinträge aus umliegenden Flächen führen zu Eutrophierung und verstärkter Gehölzsukzession, was zu einem Rückgang der Raupennahrungspflanze und einer Veränderung des Kleinklimas führt..
| Rote Liste | Schutzstatus | Verordnungen und Richtlinien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW (2025) | D (2011) | BNatSchG | EG-VO 338/97 Anhang | FFH-Richtlinie Anhang | BArtSchV | ||||
| 1 vom Aussterben bedroht | 2 stark gefährdet | besonders geschützt | streng geschützt | - | II | IV | - | besonders geschützt | streng geschützt |
- Aufforstung von geeigneten Habitaten
- Eutrophierung
- Sammeln von Tieren
- Mahd und Beweidung
- Erhalt der Feuchtbrachen
- Regulierung der Gehölzsukzession
- Entwicklung neuer Lebensräume in der Umgebung
- Erhalt der Feuchtbrachen
- Extensivierung der umliegenden Flächen
- Regulierung der Gehözsukzession
- Entwicklung neuer Lebensräume in der Umgebung
Die FFH-Richtlinie ist eine Naturschutz-Richtlinie der EU, deren Namen sich von Fauna (= Tiere), Flora (= Pflanzen) und Habitat (= Lebensraum) ableitet. Wesentliches Ziel dieser Richtlinie ist die Erhaltung der Biologischen Vielfalt durch den Aufbau eines Schutzgebietssystems. Neben der Ausweisung von Schutzgebieten (FFH-Gebieten) für Arten des Anhangs II wird auch der Erhaltungszustand dieser und der Arten des Anhangs IV und V überwacht.
FFH-Gebiete
Eine Karte der FFH-Gebiete mit Vorkommen des Blauschillernden Feuerfalters und weitere Informationen zu den Gebieten erhalten Sie im Daten- und Kartendienst der LUBW
Erhaltungszustand in Baden-Württemberg
| Verbreitungsgebiet | Population | Habitat | Zukunftsaussichten | |
|---|---|---|---|---|
| Einzelbewertung | ungünstig-schlecht | ungünstig-schlecht | ungünstig-unzureichend | ungünstig-schlecht |
| Gesamtbewertung | ungünstig-schlecht | |||
2024
Erhaltungszustand der FFH-Arten in Baden-Württemberg (pdf; 0,6 MB)