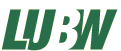Die Umweltindikatoren können zurzeit nicht aktualisiert werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Nachhaltig handeln in Baden-Württemberg heißt
… den Einsatz von Ressourcen zu optimieren und das Wirtschaftswachstum vom Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen zu entkoppeln.
Die Gewinnung oder Nutzung von Rohstoffen geht stets mit Flächen-, Material- und Energieinanspruchnahme, Stoffverlagerung sowie Schadstoffemissionen einher. Die Rohstoffproduktivität gibt das Verhältnis des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zum Verbrauch von Rohstoffen an und drückt damit aus, wie viel wirtschaftliche Leistung (dargestellt als BIP) durch den Einsatz einer Einheit Rohstoffe „produziert" wird. Der Anstieg des Indikators zeigt, inwieweit das Wirtschaftswachstum vom Rohstoffverbrauch entkoppelt werden konnte. Dabei ist allerdings eine Schwachstelle des Indikators zu beachten: Der Rohstoffverbrauch, der durch die Produktion von Importgütern im Ausland verursacht wird, wird durch den Indi-kator nur teilweise erfasst.
Die Rohstoffproduktivität ergibt sich aus dem Verhältnis des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zur Inanspruchnahme von Rohstoffen (DMC – Direct Material Consumption). Berücksichtigt werden beim DMC erneuerbare und nicht erneuerbare Rohstoffe, also der bio-tische und abiotische Inländische Materialverbrauch. Biotische Rohstoffe sind Produkte aus der Land- und Forstwirtschaft sowie Produkte aus der Tierhaltung. Zu den abiotischen Roh-stoffen gehören Energieträger und Mineralien. Dargestellt wird der zeitliche Verlauf der Rohstoffproduktivität als Index mit dem Basisjahr 2010.
Ziel ist es, den Verbrauch heimischer mineralischer Primärrohstoffe durch Steigerung der Ressourceneffizienz, ihre Substitution und das Recycling von Baustoffen zu vermindern. Ein quantitatives Ziel ist für diesen Indikator nicht definiert.
Seit 20 Jahren liegt der Rohstoffverbrauch in Baden-Württemberg – mit konjunkturbedingten Schwankungen – auf ähnlichem Niveau. Bei der Rohstoffproduktivität ist hingegen eine steigende Tendenz zu beobachten: Seit 2010 stieg die Rohstoffproduktivität in Baden-Württemberg um 14 Prozent. Die wirtschaftliche Leistung entkoppelt sich also zunehmend vom Rohstoffverbrauch im Land.
Bioabfälle stellen eine besondere Ressource dar, die sowohl stofflich als auch energetisch genutzt werden kann. Daher sind seit dem 01.01.2015 häusliche Bioabfälle gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) getrennt zu erfassen und hochwertig zu verwerten.
Eine sehr hochwertige Form der Verwertung von Bioabfällen ist die sogenannte Mehrfach-nutzung: dabei wird aus dem Bio- und Grüngut zunächst in einer Vergärungsanlage Biogas gewonnen, das zur Wärme- oder Stromgewinnung oder als Treibstoff eingesetzt wird und damit klimaschädliche Emissionen der ansonsten eingesetzten fossilen Energieträger vermie-den werden können. Flüssige Gärreste werden zu Dünger, die festen Gärreste über eine Kom-postierung zu Kompost weiterverarbeitet, der im ökologischen Landbau zur ausreichenden Nährstoffversorgung Verwendung findet.
Betrachtet wird der Anteil häuslichen Bioabfalls in Baden-Württemberg, der einer hochwerti-gen Verwertung in einer kombinierten Vergärungs- und Kompostierungsanlage mit Biogaser-zeugung und Kompostproduktion (Mehrfachnutzung) zugeführt wird. Dem gegenüberge-stellt wird der Anteil, der direkt kompostiert wird oder auf sonstige Weise behandelt oder gelagert wird.
Zentrale Aufgabe der nächsten Jahre ist es, die Infrastruktur zur hochwertigen Bioabfallverwertung in Form einer kombinierten Vergärung und Kompostierung im Land noch weiter auszubauen und zu optimieren.
2024 wurden von den Haushalten Baden-Württembergs 628 Tausend Tonnen Bioabfälle in der Biotonne gesammelt, pro Kopf knapp 56 Kilogramm. 74 Prozent des gesammelten Bioab-falls wurden einer hochwertigen biologischen und energetischen Verwertung in einer Vergä-rungsanlage zugeführt. Damit hat sich die Menge des hochwertig verwerteten Bioabfalls in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Um alle häuslichen Bioabfälle im Land bestmöglich verwerten zu können, bedarf es in Baden-Württemberg noch zusätzlicher Vergärungsanlagen.
Die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche, auch Flächenneuinanspruchnahme oder Flächenverbrauch genannt, steht als ein Indikator für eine nachhaltige Raumnutzung. Sie be-schreibt die Umwidmungen von naturnaher, meist land- und forstwirtschaftlich genutzter Fläche hin zu siedlungsbezogener Nutzung. Dabei gehen, insbesondere mit der Versiegelung von Flächen, ökologische Funktionen des Bodens selbst wie auch Lebensräume für Flora und Fauna verloren.
Baden-Württemberg strebt eine bedarfsgerechte Flächenausweisung und effiziente Flächen-nutzung an. Vor einer Neuausweisung soll vorrangig der Innenbereich, der Flächen innerhalb bestehender Siedlungs- und Verkehrsfläche bezeichnet, entwickelt werden. Im Koalitionsvertrag 2021-2026 wird eine weitere Reduzierung des Flächenverbrauchs bis hin zu einem Netto-Null-Flächenverbrauch 2035 angestrebt.
Scheunert, P., Siedentop, S., Heider, B. (2024): Raumanalyse Baden-Württemberg: Siedlungs- und Flächenentwicklung. Kurzbericht Nr. 2. Stuttgart. Online verfügbar unter: https://www.landesentwicklung-bw.de/img/download/content/downloads/raumanalyse02siedlungsflachenen.pdf,p15 (zuletzt aufgerufen am 25.09.2025).