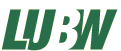null Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling - Phengaris nausithous Bergsträsser, 1779



Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling, auch Schwarzblauer (Moor-) Bläuling genannt, hat dunkle, zimtbraune Flügelunterseiten mit einer gebogenen Punktreihe pro Flügel. Bei den Männchen ist die Oberseite der Vorderflügel graublau gefärbt und besitzt eine dunkle Punktreihe. Die Flügel der Weibchen sind oberseits dunkelbraun gefärbt. Die Art ist in ihrer Entwicklung auf Bestände des Wiesenknopfes sowie auf Ameisen angewiesen. Die Raupen können sowohl die Farbe der Blüten, auf denen sie fressen, als auch den Nestgeruch der Ameisen imitieren.
Flügelspannweite: 30 mm
Entwicklungsdauer: 1 Jahr
Flugzeit: Anfang Juli bis Mitte August
Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling besiedelt nicht zu stark gedüngte, feuchte Mähwiesen, Grabenränder und junge Stadien von Feuchtwiesenbrachen mit reichen Beständen des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis). Zahlreiche Nester der Wirtsameise müssen vorhanden sein.
Die Weibchen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings legen ihre Eier bevorzugt auf Einzelblüten der rötlich gefärbten Blütenköpfchen ab. Die jungen Raupen bohren sich zunächst in die Blüten und fressen sie aus. Es können bis zu sechs Raupen in einem Blütenköpfchen heranwachsen. Halberwachsen verlassen sie die Blütenköpfchen und lassen sich von der Rotgelben Knotenameise (Myrmica rubra) in deren Nest tragen, wo sie sich von der Ameisenbrut ernähren und im Gegenzug ein zuckerhaltiges Sekret für die Ameisen hinterlassen. Bis zu vier Raupen können in einem Ameisennest ihre Entwicklung erfolgreich abschließen. Nach dem Schlüpfen aus der Puppe funktioniert die Tarnung nicht mehr, so dass der erwachsene Falter das Nest verlassen muss. Der Große Wiesenknopf dient auch den Faltern als Nektarquelle, außerdem werden seine Blütenköpfchen als Schlaf, Balz- und Paarungsplatz genutzt.
Gesamtverbreitung:
Das Verbreitungsgebiet des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings erstreckt sich von Mitteleuropa ostwärts bis zum Ural und weiter bis ins westliche Sibirien. Die südlichsten Vorkommen existieren in Anatolien und im Kaukasus. In Frankreich und Spanien existieren isolierte Arealbereiche, in den Alpen und auf der Balkanhalbinsel fehlt die Art. Im Süden und in der Mitte Deutschlands ist die Art weit verbreitet. In der norddeutschen Tiefebene fehlt die Art dagegen fast völlig.
Verbreitung in Baden-Württemberg:
In Baden-Württemberg konzentrieren sich die Vorkommen vor allem auf die Oberrheinebene, den Kraichgau, das Bodenseegebiet sowie auf Teile des Schwäbisch-Fränkischen Waldes.
Bestandsentwicklung in Baden-Württemberg:
In den besiedelten Naturräumen sind derzeit keine auffälligen Populationsverluste erkennbar. In den Hauptverbreitungsgebieten sind ausreichend vitale Populationen vorhanden.
| Rote Liste | Schutzstatus | Verordnungen und Richtlinien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW (2025) | D (2011) | BNatSchG | EG-VO 338/97 Anhang | FFH-Richtlinie Anhang | BArtSchV | ||||
| 2 stark gefährdet | V Vorwarnliste | besonders geschützt | streng geschützt | - | II | IV | - | - | - |
- Trockenlegung
- Mahd zum falschen Zeitpunkt
- Nutzung feuchter Wiesen als mehrschüriges Wirtschaftsgrünland
- Einsatz schwerer Maschinen und intensive Beweidung führen zu Bodenverdichtung, wodurch die Wirtsameisen geschädigt werden
- Düngung
- Herbizideinsatz
- Erhalt der Feuchtwiesenkomplexe durch Förderung extensiver Nutzungen oder gleichwertiger Pflegemaßnahmen
- Erhalt der Streuwiesen: Mahd im Herbst mit Mähgutabtransport
- Bereitstellung von Flächen mit unterschiedlichen Brachestadien (1- bis 3- jährige, kleinflächig wechselnde Brachen) und Flächen mit jährlicher Mahd ab Mitte September; größere Teilflächen in unregelmäßigen Abständen zweimal mähen: 1. Mahd: vor Mitte Juni, 2. Mahd: ab Anfang September
- Kleinflächig wechselnde Bewirtschaftungen unter Erhalt der begrenzenden Saumstreifen
- Schonung von Wiesenrandstreifen, Mahd nur alle 2 Jahre
- Zeitlich und räumlich differenziertes Mähen der Grabenränder und Böschungen
- Umsetzung der FFH-Richtlinie
- Arten- und Biotopschutzprogramm Baden-Württemberg
- Art des 111-Arten-Korbs
- Art des Zielartenkonzepts Baden-Württemberg
Die FFH-Richtlinie ist eine Naturschutz-Richtlinie der EU, deren Namen sich von Fauna (= Tiere), Flora (= Pflanzen) und Habitat (= Lebensraum) ableitet. Wesentliches Ziel dieser Richtlinie ist die Erhaltung der Biologischen Vielfalt durch den Aufbau eines Schutzgebietssystems. Neben der Ausweisung von Schutzgebieten (FFH-Gebieten) für Arten des Anhangs II wird auch der Erhaltungszustand dieser und der Arten des Anhangs IV und V überwacht.
FFH-Gebiete:
Eine Karte der FFH-Gebiete mit Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings und weitere Informationen zu den Gebieten erhalten Sie im Daten- und Kartendienst der LUBW.
Erhaltungszustand in Baden-Württemberg
| Verbreitungsgebiet | Population | Habitat | Zukunftsaussichten | |
|---|---|---|---|---|
| Einzelbewertung | günstig | ungünstig-unzureichend | ungünstig-unzureichend | ungünstig-unzureichend |
| Gesamtbewertung | ungünstig-unzureichend | |||
2024
Hinweis: Im Zusammenhang mit dem FFH-Bericht wird das vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) verwendete Synonym Maculinea arion als wissenschaftlicher Artname verwendet.