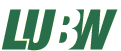Landesweites Bestandsmonitoring Weißstorch

Siedlungsbereich
Wie in weiten Teilen Deutschlands haben im vergangenen Jahrhundert auch in Baden-Württemberg die Bestände des Weißstorchs massiv abgenommen. Von einer ehemals fast landesweiten Verbreitung schrumpfte der Bestand bis 1975 auf 15 Brutpaare. Seit der Durchführung eines Aussetzungsprogramms (1981-1997) hat der Bestand ab Mitte der 1980er Jahre wieder kontinuierlich zugenommen und der Weißstorch kann als Beispiel für sehr erfolgreiche Artenschutzbemühungen genannt werden.
Im Jahr 2012 startete die LUBW im Auftrag des Umweltministeriums ein landesweites Weißstorch-Monitoring, welches zuvor vom Regierungspräsidium Karlsruhe organisiert wurde. Bei diesem beobachten ehrenamtlich tätige Personen jährlich das Brutgeschehen. Dabei werden umfangreiche Daten zu besetzten Horsten, zum Bruterfolg und zur Phänologie der Tiere erhoben. Außerdem werden Jungtiere in den Horsten beringt und die Ringe der Altvögel abgelesen. Auf diese Weise kann das Verhalten von individuell erkennbaren Tieren über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet werden. Die fachliche Betreuung und Koordination der Horstbetreuenden übernimmt eine von der LUBW beauftragte „Weißstorchbeauftragte“.

Flächen unterwegs, um Insekten, Regenwürmer, Frösche,
Reptilien zu erbeuten. Auch Mäuse gehören zu ihrem
Nahrungsspektrum.
Die Ursachen für den starken Bestandsanstieg der westdeutschen Population liegen vor allem am veränderten Zugverhalten. Die nach Südwesten ziehenden Weißstörche fliegen heute kaum noch nach Afrika, sondern verbringen den Winter zunehmend auf der Iberischen Halbinsel. Dies hat wahrscheinlich eine geringere Wintersterblichkeit zur Folge. Hinzu kommt die gute Anpassung des Weißstorchs an den Menschen und die intensiv genutzte Kulturlandschaft. Weißstörche profitieren von der verbesserten Nahrungsverfügbarkeit durch häufige Grünlandmahd und während der Feldbearbeitung. Im Winterquartier in Spanien haben sie zudem offene Mülldeponien als neue Nahrungsquelle erschlossen. Mit der nachträglichen Sicherung von Strommasten gemäß §41 Bundesnaturschutzgesetz "Vogelschutz an Energiefreileitungen" konnte zudem das Risiko für die Tiere durch Stromschlag umzukommen deutlich gesenkt werden. Wichtig bleibt es, die langfristige Populationsentwicklung, Bruterfolg und Ansiedlungen im Blick zu behalten. Nur so können die Bemühungen im Weißstorchschutz rechtzeitig angemessen auf Veränderungen reagieren.
Als Kulturfolger, der seine Horste oft auf Gebäuden oder (Hochspannungs-)masten errichtet, sind Weißstörche vielfach im Siedlungsbereich präsent. Dies führt immer wieder zu Konflikten, beispielsweise, wenn Solaranlagen auf einem Hausdach durch einen Weißstorchhorst verschattet werden. Dank des landesweiten Bestandsmonitorings gibt es vielerorts fachkundige Horstbetreuende, die in Konfliktfällen die Menschen vor Ort beraten und unterstützen können.
| Ziel |
|
| Untersuchungsumfang in BW | Möglichst vollständige Erfassung aller Horststandorte |
| Erfassungsmethodik | Regelmäßige Kontrolle der Horste während der Brutsaison zur Ermittlung, ob Horst besetzt und wie viele Jungvögel vorhanden sind; optische Erfassung mittels Fernglas und Spektiv. Details siehe Methodenstandards nach Südbeck et al. |
| Finanzierung | Landeskoordination der ehrenamtlichen Erfassungen durch die Staatliche Vogelschutzwarte an der LUBW mit Landesmitteln |
| Ansprechpartner:innen | LUBW, Staatliche Vogelschutzwarte |
Erreichte Meilensteine
Die Weißstorchbeauftragte wurde landesweit als Koordinatorin für die ehrenamtliche Erfassung etabliert. Sie arbeitet eng mit dem Max-Planck-Institut zusammen, um die Jungstörche zu beringen und die Ringe der Alttiere abzulesen. Die Horststandorte und die aktuellen Bestandszahlen werden übersichtlich auf der Plattform weißstorcherfassung.de vom NABU dargestellt.
Aktuelle Daten und Publikationen
Die jährlich aktualisierten Verbreitungsdaten des Weißstorchs in Baden-Württemberg können im Daten- und Kartendienst der LUBW eingesehen und heruntergeladen werden: https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/q/KcjpRP6JdZvhVJ8LMB0d6.