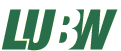Vogelmonitoring

Das Vogelmonitoring setzt sich in Deutschland aus verschiedenen Modulen zusammen und reicht in Deutschland bis in die 1930er Jahre zurück
Vögel faszinieren die Menschen schon seit langer Zeit. Viele Arten lassen sich gut beobachten und zeigen eine beeindruckende Vielfalt in ihrem Verhalten und Aussehen. Aufgrund ihrer Popularität gehören sie zu den am intensivsten erforschten Artengruppen und sind ideale Botschafter für den Naturschutz.
Der Rückgang der Biodiversität und damit auch der Vogelarten ist ein gemeinhin bekanntes Problem. Vögel stellen spezifische Anforderungen an ihren Lebensraum. Sie benötigen intakte artspezifische Strukturen, ein ausreichendes Nahrungsangebot und geeignete Brutstätten, Rast- und Überwinterungsgebiete. Daher sind ihre Bestände und deren Entwicklung eng mit Veränderungen in der Landnutzung und den Folgen des Klimawandels verknüpft. Um den Zustand unserer Landschaft erfassen und die Entwicklung der Vogelbestände mit belastbaren Daten dokumentieren zu können, ist es entscheidend, regelmäßig Daten zu den Vogelpopulationen zu sammeln. Die Daten dienen als wertvolle Indikatoren für Umweltveränderungen und zeigen, wie menschliche Aktivitäten die Natur beeinflussen. Durch ein systematisches Monitoring können schädliche Veränderungen frühzeitig erkannt und der Schutz der Biodiversität gezielt gefördert werden.
Ziel
Ziel des Vogelmonitorings ist es, regelmäßig aktuelle Informationen zur Bestandsentwicklung von Brutvögeln und rastenden Wasservögeln bereitzustellen. Die systematische Erfassung der Vogelbestände ermöglicht unter anderem Analysen von Bestandtrends und -entwicklungen. Dieses Wissen ist entscheidend, um frühzeitig Handlungsbedarfe sichtbar zu machen und zielgerichtete, artspezifische Schutzmaßnahmen zu planen, umzusetzen und zu evaluieren. Auch dienen die Ergebnisse als Grundlage für die Fortschreibung von Indikatoren, die Erfüllung nationaler und internationaler Berichtspflichten sowie für die Erstellung Roter Listen.
Aufbau
Die Anfänge des Vogelmonitorings in Deutschland reichen bis in die 1930er Jahre zurück und haben damit eine lange Tradition. Seit Beginn der ersten Kartierarbeiten hat sich die Erfassung der Brut- und Rastvogelpopulationen kontinuierlich weiterentwickelt. Heute setzt sich das Vogelmonitoring aus verschiedenen Modulen zusammen, von welchen einige bundesweit, andere landesweit koordiniert werden.
Bundesweite Programme
Das bundesweite Vogelmonitoring basiert auf einer umfassenden Kooperation zwischen Bund, Ländern und Verbänden. Basis dieser Zusammenarbeit ist die Verwaltungsvereinbarung Vogelmonitoring (VVV), welche den Umgang mit den ehrenamtlich erhobenen Monitoringdaten und deren Auswertung regelt.
Die Koordinierung der bundesweiten Monitoringprogramme erfolgt auf Bundesebene durch den Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) e. V. Eine Aufgabe des DDA ist es, die bundeslandspezifischen Monitoringdaten zusammenzuführen und aufzubereiten. In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) und den Vogelschutzwarten der Länder (VSW) erfolgt anschließend die Datenauswertung und Veröffentlichung der gewonnenen Erkenntnisse. Ein wichtiges Veröffentlichungsformat ist „Vögel in Deutschland“, in welchem die Ergebnisse des Brutvogelmonitorings zusammengefasst und ausgewählte Aspekte näher vorgestellt werden.
Auf Landesebene erfolgt die Koordination der bundesweiten Monitoringprogramme durch das jeweilige Bundesland. In Baden-Württemberg werden die Daten für die Bundesprogramme größtenteils von fachlich geschulten Ehrenamtlichen erhoben. Die Koordination der ehrenamtlichen Kartierungen erfolgt in der Regel im Auftrag der LUBW, zum einen durch das NABU-Vogelschutzzentrum Mössingen und zum anderen durch die Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW). Die Datenerhebung erfolgt nach einem bundesweit einheitlichen Methodenstandard.
Nähere Informationen zur Umsetzung des „Monitorings häufiger Brutvögel (MhB)“ und des „Monitorings seltener Brutvögel (MsB)“ in Baden-Württemberg können direkt über die Links oder den Navigationsbaum abgerufen werden.
Bei dem „Monitoring rastender Wasservögel (MrW)“ handelt es sich um ein Bundesprogramm, das in Baden-Württemberg ausschließlich ehrenamtlich durchgeführt wird. Die Internationale Wasservogelzählung ist eines der ältesten systematischen Zählprogramme für Tierpopulationen überhaupt. Ihre Anfänge reichen in Deutschland bis in die 1940er Jahre zurück. Diese ehrenamtlichen Erfassungen haben nicht nur zu einem Erkenntniszuwachs geführt, sondern auch einen sehr wichtigen Beitrag zur Etablierung eines weltweiten Netzes an Schutzgebieten für Wasservögel geleistet. Die Daten finden zudem Verwendung bei der Erstellung des nationalen Vogelschutzberichts.
Im November 2013 haben sich die regionalen Akteure der Wasservogelzählung in Baden-Württemberg auf die Etablierung einer landesweiten Koordination des Monitorings rastender Wasservögel (MrW) unter dem Dach der OGBW geeinigt. Weiterführende Informationen zum MrW können auf der Homepage der OGBW abgerufen werden.
Landesweite Programme
Die oben erwähnten Module des überwiegend ehrenamtlich getragenen Vogelmonitorings bilden die Basis eines Brutvogelmonitorings für Baden-Württemberg. Auch die fachverbandsseitig organisierte Sammlung von sogenannten Zufallsdaten kann teilweise zur Dokumentation von Bestands- und Verbreitungsentwicklungen herangezogen werden. Neben diesen bundesweit weitgehend einheitlich umgesetzten Modulen werden landesspezifische Kartierungsprogramme genutzt oder von der LUBW konzipiert und beauftragt, um mehr über die Vogelwelt in Baden-Württemberg zu erfahren.
Greifvogelmonitoring
Seit 2018 werden jährlich Daten zu festgelegten Greifvogelarten auf ausgewählten Stichproben erfasst. Die Kartierungen sind mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden. Daher wird das Greifvogelmonitoring von der LUBW an professionelle Kartiererinnen und Kartierer vergeben und nicht ehrenamtlich kartiert. Der Fokus des Programms liegt auf windkraftsensiblen Arten, deren Bestände mittels ähnlicher Methodik erfasst werden können. Das baden-württembergische Programm ist kein Teil des bereits 1988 gegründeten und mittlerweile auf Basis eines Fördervereins getragenen „Monitorings Greifvögel und Eulen Europas (MEROS)“, sondern steht für sich. Lesen Sie mehr …
Monitoring einzelner Arten bei Relevanz auf Landesebene
Bei einzelnen Arten werden aufgrund spezifischer Anforderungen oder bereits langjährig etablierter vorhandener Strukturen gesonderte Monitoringmodule auf Landesebene durchgeführt. Die Erfassungen erfolgen durch Ehrenamtliche über eine im Auftrag der LUBW stattfindende professionelle Organisation der Zählungen (Weißstorch und alle zwei Jahre Kormoran) oder in Eigenregie von einzelnen ehrenamtlich aktiven Personen (Wiesenweihe) bzw. naturschutzverbandsseitig organisiert (Uhu und Wanderfalke über die AG Wanderfalkenschutz im NABU e.V.). Die ehrenamtlich durchgeführten Kartierungen können zumindest teilweise durch die Erstattung von Reisekosten durch die Naturschutzbehörden unterstützt werden.
Die erhobenen Daten dienen u. a. der Berichterstattung im Rahmen internationaler Naturschutzvereinbarungen (EG-Vogelschutzrichtlinie). Sie stehen aber auch für die praktische Naturschutzplanung und Eingriffsbeurteilung bis hin zu Projekten der Grundlagenforschung (z.B. Auswertung von Weißstorchdaten am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie) zur Verfügung.
Sonstige Programme
Zusätzlich zu den bereits benannten Monitoringprogrammen gibt es weitere Beiträge, welche die Datengrundlage zu den Vogelarten bundes- und landesweit verbessen. Zu nennen wäre hier der DDA mit der Erarbeitung des Atlas Deutscher Brutvogelarten (ADEBAR). Institutionen wie die deutschen Vogelwarten mit Beringungsprogrammen helfen mit, die Kenntnisse zu verbessern. Auch private Vereine, wie die über Spenden finanzierte Forschungsstation Randecker Maar e.V. unterstützten mit ihrer Arbeit die systematische Erfassung der Vogelbestände.
Mitmachen
Sie möchten ehrenamtlich am Brutvogelmonitoring in Baden-Württemberg mitarbeiten? Es gibt viele Möglichkeiten, aktiv zu werden und einen wertvollen Beitrag zum Artenschutz zu leisten:
- Engagement in Verbänden wie der Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW) oder im NABU.
- Direkte Beteiligung an den Monitoringprogrammen durch Übernahme von Probeflächen (Mitmachen beim MhB; Mitmachen beim MsB; Mitmachen beim MrW) oder die Betreuung von Neststandorten beim Weißstorch.
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung! Gemeinsam können wir einen entscheidenden Beitrag zum Schutz unserer Brutvögel leisten.